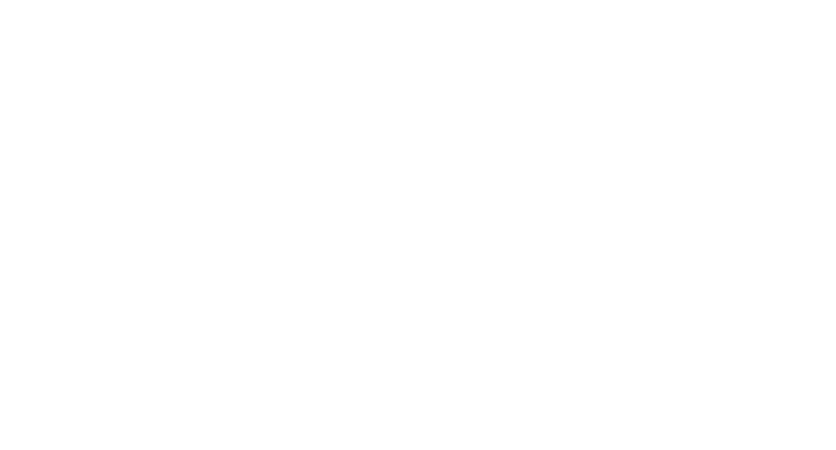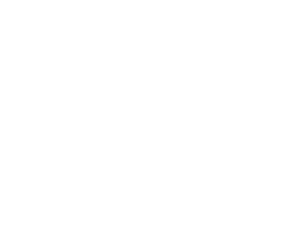Gegen Trockenheit und Hochwasserschäden: Wald als Schwamm
Landesforsten wollen Oberflächenwasser länger im Wald halten
(Osterode-Riefensbeek) Die Niedersächsischen Landesforsten erproben zurzeit im Harz neue Verfahren zum Schutz vor Hochwasser und Trockenheitsschäden. Das Pilotvorhaben „Wald als Schwamm“ im Forstamt Riefensbeek (Landkreis Göttingen) will Niederschlagswasser möglichst lange im Wald halten und dort versickern lassen. Ziel ist einerseits, die Auswirkungen von Starkregenereignissen auf Ortschaften in Tallagen abzumildern. Andererseits speichert der Waldboden mehr Wasser und kann Trockenphasen als Folgen des Klimawandels besser bewältigen. Das Waldwegenetz nimmt bei diesem Vorhaben eine Schlüsselfunktion ein. Denn die wegebegleitenden Gräben leiten Wasser aus dem Wald ab, das sonst im Boden versickern würde. Wegebau-Fachleute und Waldökologen testen im Rahmen des Projekts unterschiedliche Bauwerke und Wasserführungen. Sie sollen den Wasserabfluss insbesondere nach Starkregenereignissen und während der Schneeschmelze dämpfen. So bleiben größere Mengen Wasser im Wald zurück. Das Pilotprojekt steht kurz vor dem Abschluss.
Die vom Land Niedersachsen geförderten Erprobungsarbeiten laufen seit Sommer 2025. Auf einer Fläche von rund 288 Hektar sind bereits verschiedene Techniken eingesetzt und Maßnahmen umgesetzt worden. Bis Ende November wollen die Landesforsten rund 260.000 Euro Fördergelder in den Revierförstereien Lerbach und Buntenbock investieren.
Klimaveränderungen mit Überschwemmungen in Niedersachsen – Folgen für Wald und Forstwirtschaft
„Hochwasserschutz beginnt im Wald“, sagt Projektleiter Holger Sohns. Der Förster und Leiter des Wegebaustützpunktes der Landesforsten nennt die Bedeutung der Wege im Wald: „Sie sind wichtig für den Holztransport, als Rettungswege für den Brandschutz und zur Bergung von Verunfallten sowie für die Freizeitnutzung und Erholung. Anderseits leiten ihre Gräben das Wasser schnell aus dem Wald ab und durchbrechen damit den natürlichen Wasserfluss des Bodens. Weniger Feuchtigkeit versickert in tiefere Schichten.“ Da setzt das Projekt “Wald als Schwamm“ an. Eine Folge der Klimaveränderungen sind starke und langanhaltende Regenfälle, die häufiger auftreten werden. Diese Starkregenereignisse können zu Schäden am Wegenetz und zu Hochwasser in Ortschaften führen. Ziel des Förderprojektes ist es, die Wirtschaftswälder als Wasser-Rückhalteraum weiterzuentwickeln.
Holger Sohns und sein Team haben das Konzept für die Umgestaltung der wegebegleitenden Gräben und der Rohrdurchlässe erarbeitet. Das Team will den Wasserrückhalt verbessern. Wie gut das gelingt, wollen sie in den nächsten Jahren für die Praxis erproben. Gleichzeitig tragen die baulichen Veränderungen zur Grundwasser-Neubildung bei. Statt rasch abzufließen, versickert mehr Niederschlag im Boden. Zusätzlich fördern stehende Wasserflächen – angelegt als Tümpel entlang der Wegegräben – den Natur- und Artenschutz: Sie bilden neuen Lebensraum für Frösche, Feuersalamander oder Libellen. Diese sogenannten Wassertaschen bleiben über längere Zeit gefüllt, und Schwebstoffe im Wasser können sich dort absetzen. Von dem neuen Konzept der Landesforsten sollen alle Waldbesitzer profitieren. Die Grundidee ist auch auf private und kommunale Waldflächen übertragbar.
Bauarbeiten im Harz zwischen Buntenbock und Lerbach noch bis Ende November
Aktuell laufen die letzten Baggerarbeiten im Forstamt Riefensbeek. Oberhalb der Harzer Ortschaft Lerbach werden alte Betonröhren unter den Wegen gegen größere Spezialrohre ausgetauscht. Vor diesen Durchlassröhren sollen sich künftig die Wassermengen aufstauen und verzögert in Richtung Lerbach abfließen. „Sieben große Bauwerke mit Regenrückhalte-Funktion sind bereits fertiggestellt und 40 neue Durchlässe eingesetzt. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Ende November sind alle Wege wieder frei befahrbar“, berichtet Tobias Käse. Der Wegebau-Einsatzleiter vom Forstamt Seesen ist regelmäßig auf der Baustelle im Wald und stimmt sich mit seiner Kollegin vom Naturschutz ab. Als Landschaftsökologin ist Meike Fahning federführend an dem Projekt beteiligt. Wir können Hochwasserspitzen brechen und den Abfluss aus dem Wald verlangsamen“ erklärt Meike Fahning vom Planungsamt der Landesforsten. „Wasser, das steht, kann versickern. Wenn wir es möglichst lange oben am Berg halten können, kommt unten im Tal bei Lerbach weniger an“, lautet ihr Fazit.
Wassertaschen erfüllten noch einen weiteren Zweck, beschreibt Meike Fahning. „Sie filtern das Wasser, bevor es in die Talsperren gelangt.“ Schlammige Bestandteile setzten sich so nach und nach ab und das Wasser werde klarer. „Die Sedimente will ja keiner im Trinkwasser haben.“ Wenn weniger Schwebstoffe in die Zuläufe der Talsperren gelangten, müssten die Wasserversorger das Wasser später nicht mehr so aufwendig aufbereiten, erklärt sie. Die neu angelegten Wassertaschen haben also auch einen positiven Effekt auf die Trinkwasserqualität.
Fotos zum kostenlosen Download
https://nlf.pixxio.media/share/1763549121JtKobrtny0kXxH
Quelle: Rudolph / Landesforsten